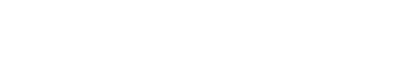Angenehmes Arbeiten in guter Luft, mit klarem Kopf und wachem Verstand: Viele Gebäudenutzer profitieren jeden Tag von Lüftungstechnik und Klimatechnik. Worüber sie dabei selten nachdenken: Hinter der Klimaanlage oder Lüftungsanlage stehen qualifizierte Kältetechniker, die sich regelmäßig darum kümmern. Aber was ist eigentlich die Definition von Lüftungs- und Klimatechnik?
Zur Klimatechnik und Lüftungstechnik zählen Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und RLT-Anlagen. Ihr Ziel: ein angenehmes Raumklima durch gezielte, energieeffiziente und sichere Lüftung, Kühlung, Beheizung und ggf. Wärmerückgewinnung.
RLT-Anlagen- und Kältetechnik: Die Zukunft der Raumluft im Griff

Was ist Lüftungs- und Klimatechnik? Grundlagen einfach erklärt
Was versteht man unter Klimatechnik und Lüftungstechnik?
Unterschiede zwischen Lüftung, Klimaanlage und Wärmepumpe
Für den Laien sind die Unterschiede manchmal verwirrend, zumal moderne Anlagen oft verschiedene Funktionen kombinieren:
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den Austausch verbrauchter Luft.
- Eine Klimaanlage kühlt die Luft und reguliert die Feuchtigkeit.
- Eine Wärmepumpe hingegen nutzt Umweltenergie zum Heizen oder Kühlen.
Warum Raumlufttechnik heute wichtiger ist denn je
Steigende Energiekosten bereiten Unternehmen wie Privatpersonen Sorgen. Und die Klimakrise macht vielen Menschen große Angst. Moderne Raumlufttechnik, vor allem Wärmepumpen und Anlagen mit Wärmerückgewinnung, punktet im Vergleich zu älteren Anlagen mit einer deutlich höheren Energieeffizienz – ein zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeit von Gebäuden.
Aufbau und Funktion von Lüftungsanlagen: Die wichtigsten Komponenten
Diese Komponenten braucht jede moderne Lüftungsanlage
Jeder qualifizierte Lüftungstechniker kennt die Komponenten einer zuverlässig funktionierenden Lüftungsanlage. Diese Bauteile arbeiten zusammen, um eine kontrollierte und effiziente Belüftung von Innenräumen zu gewährleisten:
- Zu- und Abluftkanäle
- Luftauslässe
- Ventilatoren
- Filter
- Steuerungseinheiten
- Sensoren zur Überwachung der Luftqualität
Moderne Lüftungsanlagen sollten außerdem die Wärme über einen Wärmetauscher zurückgewinnen anstatt sie in der Umgebung verpuffen zu lassen.
Der Aufbau einer typischen Lüftungsanlage erklärt
Die Funktionsweise einer Lüftungsanlage beruht auf einem einfachen Prinzip: Sie saugt verbrauchte Luft aus den Räumen ab und führt gleichzeitig frische Außenluft zu. Dabei fangen Filter Staub und Schadstoffe ab. Der Wärmetauscher entzieht der Abluft Wärme, um kühle Zuluft angenehm zu erwärmen. Über Luftauslässe gelangt die temperierte Frischluft in den Raum – für ein gesundes, angenehmes Raumklima.
So funktioniert die Luftverteilung über Lüftungssysteme
Wie Adern den Körper durchzieht ein Netz von Luftkanälen das ganze Gebäude und erreicht jeden Raum. So kann überall Abluft abgesaugt und Zuluft eingeleitet werden. Viele Luftauslässe sorgen für eine gleichmäßige Verteilung, während Ventilatoren den Luftstrom regulieren. So entsteht ein kontinuierlicher, gleichmäßiger Austausch der Raumluft.
Raumlufttechnische Anlagen richtig planen und auslegen
Anforderungen an die Planung einer RLT-Anlage
Es ist nicht gerade wenig, was Lüftungstechniker bei der Planung einer raumlufttechnischen Anlage berücksichtigen und unter einen Hut bringen müssen:
- Hygienische Problemzonen, in denen sich später gefährliche Keime entwickeln können, sind zu vermeiden. Ein anderer Sicherheitsaspekt: die durchdachte Planung von Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen, die im Ernstfall Leben retten.
- Auch wenn Zugluft nicht so lebensgefährlich ist wie Feuer und Rauch: Gebäudenutzer wollen sich keine Atemwegsinfekte und Verspannungen durch schlechte Luftführung einhandeln!
- Und nicht zuletzt: Die Energieeffizienz von Anlagen wird immer wichtiger; eine sorgfältige Planung der Lüftungstechnik wirkt sich über Jahre positiv auf die Energierechnungen aus.
Wie Klimatechniker raumlufttechnische Anlagen konzipieren
Klimatechniker setzen einen klaren Fokus auf Effizienz, Sicherheit und Komfort. Sie verschaffen sich zunächst Klarheit über die Größe der Räume und deren Nutzung und legen die wichtigsten Punkte fest, zum Beispiel die Art der Klimageräte und Kältemittel. Dann wird die ganze Anlage detailliert entworfen. Trotz aller Spezialsoftware und neuer Tools sind technisches Fachwissen, Erfahrung und regelmäßige Weiterbildung zur Klimatechnik bei der Planung so wichtig wie eh und je.
Einfluss von Raumgröße, Nutzung und Luftwechsel
Größere Gebäude brauchen mehr Power, also eine leistungsstärkere Anlage, ein größeres Luftvolumen und höheren Luftdruck. Wichtig ist aber auch, was in den Räumen später geschehen wird: Sind es Büros, Werkstätten, Aufenthaltsräume oder Sanitäranlagen? In Küchen, Duschräumen oder Räumen, in denen sich Menschen körperlich anstrengen, muss die Anlage die Luft schneller austauschen; in Konferenzräumen, Bibliotheken oder Klassenzimmern soll sie möglichst leise arbeiten.
Sind diese Fragen geklärt? Erst dann legt der Techniker die Luftwechselrate fest – im Spannungsfeld zwischen notwendigem Luftaustausch und möglichst geringem Energieverbrauch.
Jetzt Seminar mitmachen und RLT-Anlagen fachgerecht bedienen und warten!
FHB Seminarangebot zum Thema Kälte- und Raumlufttechnik:
Wartung und Betrieb von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen
Wartung von Klimaanlagen und Kälteanlagen – ein Überblick
Ihrer Anlage und den Menschen zuliebe sollten Sie die Betreiberpflicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur fachgerechte Wartung einmal, je nachdem sogar bis zu viermal im Jahr sichert Leistung und Sauberkeit der Anlage. Wichtige Punkte sind die Reinigung der Filter und Ventilatoren, die Dichtheitsprüfung und die Kontrolle des Kältemittelstands.
Wofür brauche ich eine regelmäßige Kontrolle der Wärmepumpe?
Die gute Nachricht: Für die meisten Wärmepumpen sind keine Wartungsfristen vorgeschrieben. Kümmern Sie sich dennoch um die regelmäßige Kontrolle! Sonst riskieren Sie Leistungsverluste, höhere Stromkosten, Schäden an der Anlage oder sogar einen Totalausfall. Machen Sie sich klar, dass Herstellergarantien ohne Wartungsnachweise erlöschen können. Schützen Sie Ihr teuer angeschafftes Gerät!
Sobald Ihre Wärmepumpe mehr als drei Kilogramm Kältemittel enthält, ist einmal jährlich eine gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung fällig.
Hygiene, Effizienz und Lebensdauer im Blick
Nur durch regelmäßige Wartung bleibt die Wärmepumpe hygienisch und leistungsfähig – eine Investition also, die sich langfristig auszahlt und teure Reparaturen verhindert. Wer die Wartung der Wärmepumpe vernachlässigt, atmet früher oder später schlechte Luft und bekommt immer höhere Rechnungen. Verschmutzte Komponenten verringern die Effizienz erheblich und können teure Schäden verursachen.
Sachkundenachweis nach Kategorie IV: Dichtheitsprüfung bei Kälteanlagen
Wer braucht den Sachkundenachweis für Kältetechnik?
Ohne Kältemittel keine Kühlung! Kältemittel sind das Herzstück aller Kälte- und Klimaanlagen. Leider enthalten sie Treibhausgase, die die Erde weiter aufheizen. Ist Ihre Anlage dicht oder hat sie ein oder sogar mehrere Lecks? Das muss bis zu viermal im Jahr überprüft werden. Am praktischsten ist es sicher, wenn Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter die dafür notwendige Qualifikation haben: den Kälteschein Kategorie IV. Damit erledigen Sie diese Aufgabe einfach intern. Andernfalls müssen Sie externe Dienstleister kommen lassen.
So läuft die Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen ab
Moderne Technik, zum Beispiel präzise Sensoren und Infrarottechnologie, spürt selbst kleinste Lecks auf. Bei der bewährten Stickstoffdruckprüfung wird die Anlage mit Stickstoff oder Formiergas, einem Gasgemisch aus Stickstoff oder Argon und Wasserstoff, befüllt und unter Druck gesetzt. Dann wird genau und über Stunden mit einem Manometer gemessen: Fällt der Druck ab, muss irgendwo ein Leck sein und der Prüfer macht sich auf die Suche.
Bei kleinen Anlagen reicht eine Prüfung pro Jahr. Anlagen ab 50 Tonnen Füllmenge in CO₂-Äquivalenten sind halbjährlich an der Reihe. Und die großen Anlagen ab 500 Tonnen Füllmenge werden engmaschig überwacht: alle drei Monate.
Rechtliche Grundlagen für Betreiber von Kälteanlagen
Die Rechtslage rund um Kälte- und Klimaanlagen und Wärmepumpen ist komplex und unübersichtlich. Gewissenhafte Betreiber fühlen sich von den vielen verschiedenen Regelwerken dazu oft geradezu erschlagen:
- F-Gas-Verordnung EU 2024/573, die die EU 517/2014 im März 2024 abgelöst hat
- DIN EN 378
- VDI 6022
- Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung (ArbSchG, BetrSichV)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV Regel 100-500
- Gesetz zur Gebäudeenergie (GEG)
Besonders streng sind die Vorgaben zu Dichtheitsprüfungen, da fluorierte Gase in den Kältemitteln das Klima stark belasten. Zum Glück bietet das FHB praxisnahe Seminare zur Kältetechnik an.
Beim FHB erfahren Sie alles über Betrieb und Wartung von Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen.
FHB Seminarangebot zum Thema Kälte- und Raumlufttechnik:
Hygiene in RLT-Anlagen: Anforderungen nach VDI 6022 Kategorie A
Was bedeutet VDI 6022 Kategorie A konkret für Betreiber?
Nur wer eine Schulung nach VDI 6022 absolviert hat, kann RLT-Anlagen rechtssicher prüfen. Für einfache Hygienekontrollen reicht zwar eine Schulung der Kategorie B, aber die Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6022 und jede weitere Hygieneprüfung verlangen Kategorie A. Diese Schulung deckt alles ab, was Sie rund um Ihre Anlagen wissen und beachten müssen – und dauert trotzdem nur zwei Tage.
Hygieneinspektionen bei raumlufttechnischen Anlagen
Schritt für Schritt – So bekommen Sie Ihre Pflichten rund um Ihre RLT-Anlagen in den Griff:
Benennen Sie einen zuverlässigen Mitarbeiter – oder übernehmen Sie selbst diese Rolle – als Hygieneverantwortlichen, der sich durch eine Schulung zertifizieren lässt, sich an die Arbeit macht und:
- alle RLT-Anlagen erfasst
- einen Plan für Hygieneinspektionen, Wartung, Reinigung und Filterwechsel erstellt
- alle Maßnahmen sorgfältig dokumentiert
- durch Auffrischungsschulungen stets auf dem aktuellen Stand der Technik und der Richtlinien bleibt.
Typische Mängel und wie Sie sie vermeiden
Die typischen Mängel lassen sich glücklicherweise relativ einfach und zuverlässig vermeiden: durch regelmäßige Wartung, Reinigung und rechtssichere Hygieneinspektionen nach VDI 6022.
So vermeiden Sie verschmutzte Filter, die die Luftqualität in den Räumen verschlechtern und den Energieverbrauch erhöhen, mikrobielle Verunreinigungen in Befeuchtern oder Luftkanälen und undichte Kanäle, die zu Energieverlusten führen. Sie sehen: Die Einhaltung der Vorschriften lohnt sich!
Buchen Sie Ihr Seminar zur Qualifizierung nach Kategorie A am besten hier beim FHB.
FHB Seminarangebot zum Thema Kälte- und Raumlufttechnik:
VDI 6022 Kategorie B: Hygieneschulung für Wartungspersonal
Warum die Hygieneschulung nach VDI 6022 für Techniker Pflicht ist
Auch wer „nur“ Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten oder einfache Hygienekontrollen übernehmen möchte, muss eine Qualifikation nachweisen. Die Qualität der Luft, die wir atmen, ist eben ein ernstes Thema. Nach der Schulung nach VDI 6022 Kategorie B dürfen Sie zwar weder die Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6022 noch die weiteren Hygieneprüfungen übernehmen, aber trotzdem schon wichtige Arbeiten an der RLT-Anlage erledigen.
Inhalte und Dauer der VDI 6022 Kategorie B Schulung
An nur einem Tag gut auf Ihre neuen Aufgaben vorbereitet: In der Schulung nach VDI 6022 Kategorie B erhalten Sie als Haus- und Betriebstechniker, Kundendienst- oder Servicemonteur sowie als Betreiber von RLT-Anlagen wertvolles Fachwissen: Welche technischen Regeln, gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften müssen Sie beim Betrieb von RLT-Anlagen beachten? Wie erkennen und vermeiden Sie potenzielle Gesundheitsrisiken? Wie dokumentieren Sie Ihre Arbeit korrekt? So können Sie Ihre Verantwortung im Alltag kompetent wahrnehmen und den Anforderungen der VDI 6022 gerecht werden.
Wer braucht Kategorie A – und wer B?
Welche Schulung ist die richtige? Das hängt nicht nur davon ab, welche Aufgaben Sie übernehmen wollen. Prüfen Sie auch, ob Sie die nötigen Voraussetzungen mitbringen:
Für die Teilnahme an der Schulung der Kategorie A sollten Sie einen Meister- oder Technikerabschluss in der Technischen Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik oder einem ähnlichen Fachgebiet haben und zudem mehrjährige praktische Erfahrung mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) vorweisen können.
Alternativ haben Sie eine spezialisierte Ausbildung in Bereichen wie Hygiene, Umweltmedizin oder Mikrobiologie abgeschlossen und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Raumlufttechnik.
Für die Schulung der Kategorie B sollten Geselle oder Facharbeiter in der Lüftungs- oder Anlagentechnik oder in einem verwandten Beruf sein und über mehrere Jahre Erfahrung in der Wartung von RLT-Anlagen verfügen.
Qualifizieren Sie sich hier für Hygienearbeiten nach VDI 6022 Kategorie B.
FHB Seminarangebot zum Thema Kälte- und Raumlufttechnik:
Gesetze und Normen in der Lüftungs- und Klimatechnik – ein Überblick
Diese Gesetze gelten für Lüftungsanlagen und Klimaanlagen
Beim Betrieb und der Wartung von Lüftungsanlagen und Klimaanlagen gelten einige wichtige Vorschriften. Neben dem Gebäudeenergiegesetz spielen vor allem das Arbeitsschutzgesetz und die Betriebssicherheitsverordnung eine zentrale Rolle. Auch Umweltschutz steht im Fokus; besonders das Wasserhaushaltsgesetz und die Chemikalien-Klimaschutzverordnung sind hier relevant. Wer kältetechnische Anlagen betreibt, muss daher auf regelmäßige Wartung, sichere Bauteile und umweltgerechten Betrieb achten.
DIN 1946, EnEV & Co.: Was ist für die Raumlufttechnik wichtig?
Die DIN 1946 ist für die Raumlufttechnik in Wohnungen und ähnlich genutzten Räumen wichtig: Sie regelt Planung, Ausführung und Betrieb von Lüftungsanlagen. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist allerdings obsolet; sie wurde vom Gebäudeenergiegesetz abgelöst, das auch Energiesparmaßnahmen einfordert.
Andere wichtige Gesetze, Vorschriften und Richtlinien sind die EU-Verordnung 2024/573, die die ältere EU 517/2014 im März 2024 abgelöst hat, die DIN EN 378, die VDI 6022, die Chemikalien-Klimaschutzverordnung, das Wasserhaushaltsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung und die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Regel 100-500.
Welche Rolle spielt der Klimatechniker bei der Umsetzung?
Die Rolle des Klimatechnikers ist zentral. Er plant, installiert und wartet die Systeme fachgerecht und achtet dabei auf Vorschriften zur Energieeffizienz, Sicherheit und Hygiene. Zudem sorgt er für den sicheren Umgang mit Kältemitteln und die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften. Kurz: Er ist der Spezialist, der Technik, Komfort und Vorschriften in Einklang bringt.
Raumluftqualität und thermische Behaglichkeit: Worauf es ankommt
Wie gute Luft das Wohlbefinden beeinflusst
Gute, saubere Luft mit genug Sauerstoff ist eine Wohltat: Sie verbessert die Konzentration, verringert Müdigkeit und senkt das Risiko von Kopfschmerzen oder Reizungen der Atemwege. Frische, gut gefilterte Luft ohne Allergene und CO₂ steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Stimmung. Besonders in Innenräumen trägt eine ausgewogene Luftqualität entscheidend zu Gesundheit, Komfort und Lebensqualität bei.
Der optimale CO₂-Wert in Räumen – und wie man ihn erreicht
Die Deutschen gelten als Weltmeister im Lüften: Fenster auf, Sauerstoff rein! heißt es in den meisten Wohnungen mehrmals am Tag. Ein guter Anhaltspunkt für die Raumluftqualität ist die CO₂-Konzentration. Unter 1.000 ppm (parts per million) sind laut Umweltbundesamt optimal. CO₂-gesteuerte Lüftungsanlagen messen und regulieren diesen Wert fortlaufend, um den optimalen CO₂-Gehalt in Räumen dauerhaft zu erhalten.
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Zugluft richtig regeln
Damit Menschen sich wohlfühlen, müssen mehrere Parameter stimmen und zusammenpassen:
Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40 % und 60 % liegen. Ist sie zu niedrig, helfen Luftbefeuchter oder Zimmerpflanzen; bei zu hoher Feuchte sorgen Lüftung oder Entfeuchter für Ausgleich.
Für die Raumtemperatur sind 20-22° C optimal, für Werkshallen 18° C. Flure und Treppenhäuser können deutlich kühler sein: 15° C reichen hier vollkommen aus. Thermostate und smarte Heizsysteme halten die Temperatur automatisch konstant.
Zugluft am Arbeitsplatz wird auf die Dauer unangenehm. Ursache sind oft schlecht abgedichtete Fenster oder falsche Lüftung. Abhilfe schaffen dichte Fensterrahmen, richtig platzierte Lüftungsauslässe und regulierbare Lüftungssysteme.
Energieeffiziente Lüftungssysteme und Wärmerückgewinnung nutzen
Was ist Wärmerückgewinnung – und wie funktioniert sie?
Beim Lüften wird es kalt und die Heizungen fangen an zu glühen: Das war einmal. Moderne Technik macht es möglich, die Luft auszutauschen und trotzdem ihre Wärme zu einem großen Teil zu sichern: durch Wärmetauscher, die die Wärme aus dem Abluftstrom auf den Frischluftstrom übertragen. Eine dünne Wärmeleitfläche zwischen den Luftströmen macht es möglich. Durch Wärmerückgewinnung lässt sich Energie einsparen, der Heizbedarf senken und die Effizienz von Gebäuden oder Anlagen steigern.
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung: Lohnt sich das?
Die anfänglichen Investitionskosten schrecken zwar zunächst ab; ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung amortisiert sich jedoch über die Jahre. Die billigeren Lüftungsanlagen ohne Wärmetauscher dagegen werden nach der Montage umso teurer, denn sie pusten die Wärme mit der Luft hinaus. Die Folge: Die Heizungen müssen fortlaufend nachheizen – und das sehen Sie auf den Rechnungen.
Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Anlagen
Die Dämmungsvorschriften des Gebäudeenergiegesetzes zielen auf luftundurchlässige Gebäudehüllen ab. Um den Menschen im Inneren dennoch genug Luft zu verschaffen, regelt das Gesetz in Teil 4 die Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik. Für Lüftungsanlagen wichtig zu wissen: Ab einer Luftleistung von 4.000 m³/h ist Wärmerückgewinnung Pflicht.
Deutschland hat sich die Einhaltung der Klimaziele auf die Fahnen geschrieben und fördert energetische Sanierungsmaßnahmen kräftig: neben der Dämmung, dem Einbau von Wärmepumpen und besseren Fenstern eben auch die Anschaffung oder Modernisierung von Lüftungsanlagen. Genaue und immer aktuelle Informationen stellt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf seiner Website bereit.
Hygiene bei Luftbefeuchtern: Anforderungen und Empfehlungen nach VDI 6022
Luftbefeuchter hygienisch betreiben – das ist zu beachten
Zu trockene Luft ist schlecht für unsere Atemwege: Reizungen im Rachen, trockene Schleimhäute, Infekte und auch brennende Augen hat jeder schon erlebt. Luftbefeuchter schaffen Abhilfe. Jedoch lieben auch Bakterien und Keime Feuchtigkeit. Die Lösung: gründliche Hygiene und sorgfältige Reinigung der Luftbefeuchter.
Anforderungen an die Wasserqualität und Wartung
Die VDI 6022 Blatt 6 befasst sich mit der Planung, dem Betrieb und der Wartung von dezentralen Luftbefeuchtern. Übrigens fallen auch dekorative Wasserfälle und Springbrunnen in Räumen unter diese Vorschrift; sie setzen schließlich auch Wasserdampf frei. Vorgeschrieben sind halbjährliche Inspektionen zur Gefährdungsbeurteilung und Wartungen der kritischen Anlagenteile wie Pumpen alle 6 bis 8 Monate. Werden die Richtwerte überschritten? Dann halbieren sich diese Fristen, bis alles wieder im Lot ist.
Legionellen und Co.: Hygienevorschriften bei Luftbefeuchtung
Die VDI-Richtlinie verlangt auch, alle sechs Monate Proben aus dem Befeuchterwasser zu untersuchen. Dabei dürfen die Legionellenkonzentration 100 KBE pro 100 ml und die Gesamtkoloniezahl 150 KBE pro ml nicht überschreiten. KBE steht für koloniebildende Einheiten, also kleine Ansiedlungen von Organismen, die sich vermehren. Alle Prüfungen sind dokumentationspflichtig.
Dichtheitsprüfung bei Lüftungskanälen: So funktioniert’s
Warum eine dichte Lüftungsanlage so wichtig ist
Eine noch so sorgfältig eingestellte Lüftungsanlage liefert keine guten Ergebnisse, wenn die Lüftungskanäle undicht sind. Denn dann arbeitet die Anlage einerseits gegen den Luftverlust an, erhöht den Druck und muss mehr Luft erhitzen oder kühlen als nötig. Andererseits kommt die eingestellte Luftmenge nicht bei den Menschen an und die Luftqualität im Raum lässt zu wünschen übrig.
An undichten Stellen können sich außerdem Schimmel oder Bakterien ansammeln, die die Gesundheit schädigen.
Methoden der Leckageprüfung bei RLT-Anlagen
Undichte Stellen zu finden ist gar nicht so schwer. Wichtig ist jedoch, noch während der Montage die Dichtheit der Lüftungskanäle zu überprüfen und sofort nachzubessern. Nie wieder sind alle Bauteile so gut zugänglich. Die DIN EN 12599 legt fest, welche Prüfverfahren, Messmethoden und Geräte zu diesem Zeitpunkt verwendet werden müssen, um die Eignung der Anlage zu bestätigen.
Dokumentation und Nachweispflichten für Betreiber
Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfung sind vor allem für die Übergabe einer RLT-Anlage nach der Montage wichtig. Die DIN EN 12599 legt auch fest, dass diese Messungen durch einen vollständigen Bericht aller Prüfungen dokumentiert werden müssen.
Schallschutz in der Lüftungstechnik: Geräusche effektiv reduzieren
Wie entsteht Lärm durch Lüftungsanlagen?
Es ist wohl nicht ganz zu verhindern: Allein die Luftbewegung in einer Lüftungsanlage verursacht Strömungsgeräusche. Schon bei der Planung entscheidet es sich: Strömt die Luft ungestört durch Kanäle oder verwirbelt sie lautstark an Hindernissen? Pfeift sie hörbar durch undichte Stellen oder bleibt sie leise in der Anlage?
Auch die Ventilatoren und ihre Motoren machen Geräusche, die durch die Lüftungskanäle im schlimmsten Fall über lange Strecken in jeden Raum weitergetragen werden. Je älter und verschlissener ein Bauteil, desto lauter wird es.
Schallschutzmaßnahmen bei raumlufttechnischen Systemen
Sorgfältige Wartungstechniker können den Gebäudenutzern viele nervenaufreibende Geräusche ersparen: Sehen Sie bei der Wartung genau hin: Lockere Bauteile klappern schnell im Luftstrom; dabei müssten sie nur besser befestigt werden. Durch verschmutzte Filter muss sich die Luft mit Druck und entsprechender Geräuschentwicklung durchkämpfen; da wirkt eine Reinigung oder ein Austausch Wunder. Motoren mit Unwucht oder kaputtem Lager sind ebenfalls zu laut und gehören ausgetauscht.
Nachfragen lohnt sich: Die Gebäudenutzer kennen die Lüftungsanlage gut und geben bestimmt gern Tipps, wo Sie nachschauen sollten
Leise lüften – diese Systeme arbeiten besonders geräuscharm
Der Einsatz schallgedämmter Komponenten wie geräuschoptimierter Ventilatoren und isolierter Gerätegehäuse reduziert Luft- und Körperschall effektiv. Wichtig ist auch die Entkopplung von Geräten und Kanälen durch Schwingungsdämpfer oder flexible Verbinder, die die Übertragung von Vibrationen stoppen.
Je größer die Kanäle, desto geringer sind die Strömungsgeräusche. Kanäle ohne abrupte Richtungswechsel vermeiden Turbulenzen.
Brandschutz bei Raumlufttechnischen Anlagen: Vorschriften und Maßnahmen
Brandlast reduzieren durch sichere Lüftungskonzepte
Lüftungsanlagen werden zum gefährlichen Brandbeschleuniger, wenn Feuer sich durch ihre Dämmmaterialien fressen und giftiger Rauch durch die Kanäle ungehindert das ganze Gebäude durchdringen kann. Deshalb ist ein umfassender Brandschutz bei Lüftungsanlagen essenziell. Automatische Abschaltvorrichtungen zum Beispiel stoppen die Lüftungsanlage im Brandfall.
Dämmmaterialien sind zwar unverzichtbar, wenn Luftkanäle warme Luft durch kalte Gebäudeteile führen, dürfen jedoch einem Feuer keine Nahrung geben, also nur schwer entflammbar sein.
Brandschutzklappen und Abschottungen in der Praxis
Feuerwiderstandsfähige Brandabschnittswände, einfacher ausgedrückt: Brandwände – verhindern die Ausbreitung von Feuer durch ein Gebäude. Das nützt natürlich nichts, wenn Lüftungskanäle dem Feuer den Weg ebnen. Auch an Brandschutzklappen und Rauchmeldern in Lüftungsanlagen sind Wartungen unverzichtbar, denn Verschmutzungen beeinträchtigen ihre Funktion.
Rechtliche Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen
Die Musterbauordnung (MBO), auf der die Landesbauordnungen der Bundesländer basieren, bestimmt in § 41: Lüftungsanlagen müssen den Anforderungen des Brandschutzes entsprechen und weitgehend (einschließlich Verkleidungen und Dämmungen) aus nicht brennbaren Materialien bestehen.
Auch zu beachten: die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (M-LüAR), die DIN 18017‑3 zur Lüftung in innenliegenden Sanitärräumen, die DIN 1946‑6 zur Lüftung von Wohngebäuden, die DIN EN 1366‑2 zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Brandschutzklappen und die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2).
Zukunft der Lüftungs- und Klimatechnik: Smart HVAC und nachhaltige Systeme
Smart Lüftungsanlagen: So funktioniert intelligente Raumlufttechnik
Frische, kühle oder warme Luft ganz automatisch, egal, was gerade los ist: lange Besprechung oder Wochenende? Feierabend oder großes Betriebsfest? Smarte Lüftungsanlagen regulieren die Luftqualität selbstständig, indem sie Temperatur, Feuchtigkeit und CO₂-Werte laufend messen und ihren Betrieb automatisch anpassen. Über Apps und Displays steuerbar, lassen sie sich individuell programmieren.
Nachhaltige Kältetechnik: CO₂-neutrale Alternativen im Überblick
Wenn Sie eine Klimaanlage betreiben, sind Sie nicht gleich ein Klimasünder. Entscheiden Sie sich für das richtige Kältemittel! Natürliche Alternativen wie CO₂, Ammoniak oder Wasser sind umweltfreundlicher, denn sie verursachen keinen oder nur geringen Treibhauseffekt. Sie unterliegen daher auch nicht der EU-F-Gas-Verordnung. Für nahezu jedes fluorierte, also klimaschädliche Kältemittel gibt es eine bessere Alternative für Ihre Kältetechnik.
Die Rolle von Wärmepumpen in der klimaneutralen Gebäudetechnik
Wärmepumpen sind für das Klima ein Game-Changer. Sie nutzen Umgebungswärme aus Luft, Erde oder Wasser und wandeln sie effizient in Heizenergie um – ganz ohne fossile Brennstoffe. Sie stoßen wenig CO₂ aus und können mit erneuerbarer Energie betrieben werden. In Kombination mit guter Dämmung und smarter Steuerung ermöglichen Wärmepumpen eine nachhaltige, zukunftssichere Wärmeversorgung für Neubauten und sanierte Bestandsgebäude.
FAQ
Weitere Hinweise zum Thema:
Fugen, Risse, undichte Türen und Fenster lassen unangenehmen, unkontrollierten Luftzug durch und wirken wie Gegenspieler der RLT-Anlage. Nur wenn die Gebäudehülle möglichst dicht ist, kann die RLT-Anlage gezielt und effizient für Frischluftzufuhr, Luftaustausch und Wärmerückgewinnung sorgen.
Regelmäßige Wartungen sind essenziell: Saubere Wärmetauscher, Filter und Ventilatoren, gut eingestellte Thermostate und intakte Dichtungen sorgen für einen effizienten Betrieb. Auch eine bedarfsgerechte Steuerung der Kältetechnik mithilfe moderner Sensoren und Regeltechnik verhindert unnötigen Energieverbrauch.
Zu hohe Luftmengen führen oft zu Zugluft und Lärmbelästigung, während zu geringe Luftmengen schlechte Luftqualität, CO₂-Anreicherung und Konzentrationsprobleme verursachen. Auch die Feuchtigkeit kann aus dem Gleichgewicht geraten: Ist die Luft zu trocken, entstehen Reizungen der Schleimhäute; ist sie zu feucht, drohen Schimmelbildung und Bauschäden. Zudem kann eine ungleichmäßige Verteilung der Luft zu Temperaturunterschieden und damit zu einem unangenehmen Raumgefühl führen.
Der Umgang mit Kältemitteln erfordert das Einhalten arbeitshygienischer Standards. Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille oder ein Gesichtsschutz verhindern Kälteverbrennungen durch flüssige Kältemittel, Flüssigkeitsspritzer oder Sprühnebel. Eine ausreichende Belüftung der Arbeitsräume ist notwendig, um das Einatmen von Kältemitteldämpfen zu vermeiden.
Die Digitalisierung revolutioniert den Betrieb raumlufttechnischer Anlagen durch intelligente Vernetzung und automatisierte Steuerung. Moderne Sensoren erfassen in Echtzeit relevante Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt und Feinstaubbelastung. Auf Basis dieser Daten passen sich die Anlagen dynamisch an den tatsächlichen Bedarf an – das spart Energie und erhöht den Nutzerkomfort. Zudem erlaubt die digitale Auswertung langfristige Optimierungen im Betrieb – für ein gesundes Raumklima bei minimalem Ressourceneinsatz.
In der Lebensmittelindustrie entstehen beim Backen, Braten oder Frittieren große Mengen an Fettnebel, Dampf und anderen luftgetragenen Stoffen, die die Produktionshygiene und Sicherheit erheblich beeinträchtigen.
Die gut erreichbaren Teile der Küchenabluftanlage sollten täglich kontrolliert und gereinigt werden. Aerosolabscheider sind alle zwei Wochen zu prüfen, bei intensiver Nutzung sogar täglich. Abluftfilter und Lüftungsdecken müssen mindestens einmal im Monat kontrolliert werden, während andere lüftungstechnische Anlagenteile alle sechs Monate überprüft werden sollten. Mehr über die Vorschriften zu Küchenabluftanlagen erfahren Sie hier. Oder buchen Sie gleich das FHB-Seminar zur Lüftungstechnik in Küchen.
Energiemonitoring-Systeme spielen in der Kältetechnik eine zentrale Rolle für Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit. Sie erfassen und analysieren kontinuierlich den Energieverbrauch von Kälteanlagen sowie relevanter Komponenten wie Verdichter, Pumpen und Ventilatoren. So lassen sich Energieverluste frühzeitig erkennen, Betriebsparameter optimieren und Einsparpotenziale gezielt nutzen.
Schallgedämmte Komponenten wie leise Ventilatoren und isolierte Gehäuse verbessern die Akustik. Auch größere Luftkanäle, strömungsgünstige Führungen und Schwingungsdämpfer verringern Geräusche.
Eine sorgfältige Wartung kann störende Geräusche von Lüftungsanlagen deutlich reduzieren, denn lose Bauteile, verschmutzte Filter oder defekte Motoren sind häufige Lärmquellen.
In Wohngebäuden liegt der Fokus der Lüftungstechnik auf Komfort, Energieeffizienz und leiser, zugfreier Luftführung. In Industriegebäuden steht dagegen häufig die Prozesslufttechnik im Vordergrund – z. B. für Maschinenkühlung, Staubabsaugung oder die Einhaltung spezieller Luftreinheitsklassen. Daher bewegen Industrieanlagen deutlich mehr Luft mit leistungsstärkeren Komponenten.